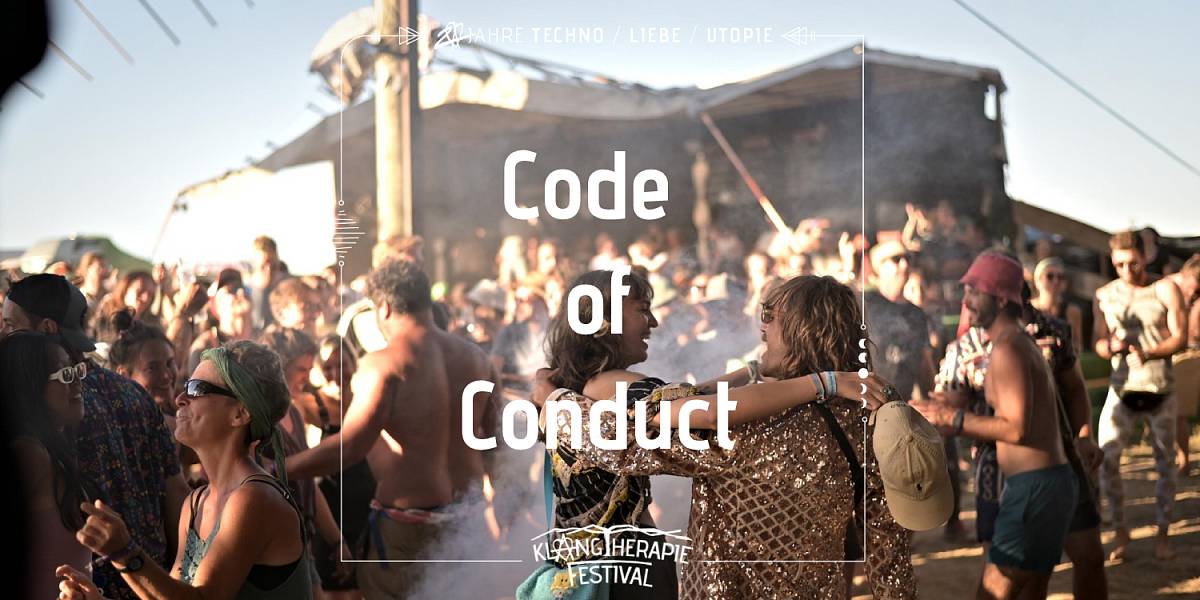Der Code of Conduct ist ein Verhaltenskodex, mit dem wir festhalten, wie wir auf der Klangtherapie miteinander umgehen wollen.Techno – Liebe – Utopie ist was wir wollen. Mit dem Code of Conduct stellen wir uns den Herausforderungen, die das Erschaffen dieser Utopie bedeutet. Wir möchten einen Raum schaffen, in dem wir ALLE die Freiheit haben, sein zu können wie wir sind.
Deshalb: Mit Betreten des Klangtherapie-Geländes stimmst du unserem Code of Conduct zu. Jeder Verstoß gegen den Code of Conduct wird geahndet und kann unter Anwendung des Hausrechts zum Ausschluss vom Festival führen. Der Ticketpreis wird in diesem Fall nicht erstattet. Wir behalten uns außerdem die Aussprache eines längerfristigen Hausverbotes vor.
- Wir tolerieren keine Form von Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Ableismus sowie andere Formen von Diskriminierung, sexualisierter Gewalt und anderem übergriffigem Verhalten!
- Wir achten die eigenen Grenzen und die eines jeden Mitmenschen. Was für dich okay ist, kann für andere Menschen schon eine Grenzüberschreitung sein. Respektiert die individuellen Grenzen. Außerdem: nicht alle Menschen wollen gerne fotografiert werden. Frage nach, wenn du ein Foto von jemandem machen möchtest – auch deine Freund*innen!
- Konsens ist Key – handle nach enthusiastischem Konsensprinzip, denn nur JA!! heißt Ja!
- Das äußere Erscheinungsbild sagt nichts über die Geschlechtsidentität einer Person aus. Bitte geh sensibel und respektvoll mit dir und anderen um. Nutze gendersensible Sprache und frag deine Mitmenschen, mit welchen Pronomen sie angesprochen werden möchten.
- Wir machen alle Fehler. Wenn Personen diskriminierende Sprache oder Denkweisen verwenden, versuchen wir sie durch konstruktive Kritik darauf aufmerksam zu machen. Wir bitten dich, offen und wertschätzend konstruktiver Kritik zuzuhören.
- Aus Solidarität und zum Bewusstmachen der eigenen Privilegien, haben wir uns für eine No Nipples Policy an den Bars entschieden. Wir bitten dich, im Gedränge das Shirt anzulassen bzw. Nippel zu bedecken. Wir wollen eine möglichst angenehme und achtsame Atmosphäre für ALLE schaffen.
- Auch im Klangtherapie-Universum gibt es Machtgefälle. Crew & Artists tragen eine besondere Verantwortung gegenüber Gäst*innen. Machtgefälle wirken auch in intimen Kontakten und machen Konsens schwierig. Sei dir dieser Ungleichheit bewusst.
- Auch dieses Jahr gibt es ein Awareness-Team, für Unterstützung in verschiedenen Situationen: Z.B. bei Diskriminierung, sexualisierter Gewalt, Grenzüberschreitungen, Panikattacken oder anderen mentalen Belangen. Die betroffene Person definiert selbst, wann und welche Form von Diskriminierung/Gewalt/Übergriffen sie erlebt hat. Diese Definition wird nicht in Frage gestellt. Das Awareness-Team arbeitet streng vertraulich und ist rund um die Uhr erreichbar unter +49 176 52616997.
- Bitte achte nicht nur auf deine Mitmenschen, respektiere auch die Natur und hinterlasse möglichst wenig Spuren. Uns ist es außerdem super wichtig, dass du unsere Infos durchliest und beachtest – insbesondere zu “Camping”, “Jugendliche & Kinder” und “auf dem Festival”!
Wenn du mitbekommst, dass andere Festivalgäst*innen sich nicht an den Code of Conduct halten, kontaktiere bitte die Security oder das Awareness-Team (+49 176 52616997).
Lasst uns gemeinsam Veränderung leben!
Techno - Liebe - UTOPIE
Glossar
Manche Definitionen wachsen im Laufe der Zeit. Die folgenden Definitionen sind Ergebnisse einiger Recherchearbeit, aber perfekt sind sie vielleicht dennoch nicht. Wir freuen uns über Austausch und deine präzisen Formulierungen: awareness@klangtherapie-festival.de
Diskriminierung
Diskriminierung ist ein soziales Phänomen der Benachteiligung, Abgrenzung und Abwertung. Als Diskriminierung wird jede ungerechtfertigte Ungleichbehandlung verstanden, die bewusst oder unbewusst stattfindet und vom Machtsystem unterstützt wird. Gruppen oder einzelnen Personen werden aufgrund individueller oder gruppenspezifischer (vermeintlicher) Merkmale benachteiligt, abgewertet und unterdrückt. Diskriminierung kann für die diskriminierte Person verheerende Konsequenzen nach sich ziehen, ihr Wohlbefinden sowie psychische Stabilität, Lebenserwartung, berufliche Aussichten uvm. massiv beeinträchtigen.
Es gibt verschiedene Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel:
Rassismus
Rassismus steht für die Diskriminierung, Abwertung und Ausgrenzung strukturell benachteiligter Gruppen oder einzelner Menschen aufgrund tatsächlicher oder zugeschriebener körperlicher oder kultureller Merkmale (z.B. Hautfarbe, Herkunft, Sprache, Religion). Durch Rassismus ist keine gleichberechtigte Teilhabe der Betroffenen an der Gesellschaft möglich. Rassistisch ist eine Aussage, die auf Logiken von Rassenideologie beruht.
Antisemitismus
Antisemitismus ist eine Weltanschauung, die in der Existenz jüdischer Personen die Ursache aller Probleme sieht. Die Wortneuschöpfung ‚Antisemitismus‘ drückt eine veränderte Auffassung von Juden*Jüdinnen aus, die nicht primär über ihre Religion definiert werden, sondern als Volk, Nation oder Rasse. Betroffen sind daher nicht nur Personen jüdischen Glaubens, sondern auch weitere, jüdisch markierter (=interpretierte) Menschen. Zu Antisemitismus gehören Vorstellungen und Argumentationsmuster, die Verschwörungsdenken, Leugnung und Relativierung der Shoah, Boykottaufrufe israelischer Produktionen, Behandlung jüdisch markierter Personen als stellvertretend für Israel oder beispielsweise eine Gleichsetzung der israelischen Politik mit den Verbrechen der Nationalsozialist*innen ausdrücken.
Sexismus
Sexismus bezeichnet verschiedene Formen der Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres (gelesenen) Geschlechts. Der Begriff Sexismus steht außerdem für die zugrundeliegende Ideologie, die Geschlechterrollen festschreibt und hierarchisiert. Die Erscheinungsformen von Sexismus sind kulturell und historisch bedingt. Sexismus zeigt sich insbesondere in der Marginalisierung von Frauen, trans*, nicht-binären und inter* Menschen.
Ableismus
Ableismus/Behindertenfeindlichkeit beschreibt die Diskriminierung aufgrund körperlicher, geistiger und/oder psychischer Behinderung. Grundlage ist ein teilweise konstruiertes Bild von Gesundheit und Fähigkeiten. Menschen, die davon abweichen, werden als “unfähig” (“disabled”), krank oder beeinträchtigt bezeichnet und auf dieses Merkmal reduziert, dadurch entmenschlicht. Kompetenzen in anderen Lebensbereichen werden abgesprochen.
Ein Mensch ist nicht, sondern wird durch eine barrierenbauende Gesellschaft behindert. Der Begriff „Mensch mit Behinderung“ wird in der UN-Behindertenrechtskonvention verwendet und kann somit als valide Selbstbezeichnung verwendet werden.
Ageimus bzw. Altersdiskriminierung
Altersdiskriminierung bzw. -feindlichkeit ist eine Form der Diskriminierung aufgrund des Alters.
Altendiskriminierung beschreibt die Benachteiligung von Menschen in einem relativ hohen Alter.
Auch jüngere und junge Menschen können Diskriminierung aufgrund ihres Alters erfahren. Adultismus bedeutet die Herabsetzung von Kindern aufgrund ihres Alters, indem ihnen Weisheit, Reife, Selbstständigkeit oder Intelligenz aufgrund ihres Alters abgesprochen und gesellschaftliche Teilhabe verwehrt werden.
Klassismus
Klassismus ist eine Form der Diskriminierung, bei der Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder zugeschriebenen sozialen Stellung in der Gesellschaft Diskriminierung erfahren. Klassismus betrifft vor allem Menschen, die arbeitslos und von Armut betroffen sind, Arbeiter*innen oder Menschen mit keinem oder niedrigem formalen Bildungsabschluss. Der soziale Status ist als einziges Diskriminierungsmerkmal nicht im Gleichbehandlungsrecht verankert.
Grenzüberschreitung
Eine Grenzüberschreitung ist ein Verhalten, dass persönliche Grenzen einer Person überschreitet. Die Täter-Person ist sich dieser Grenzüberschreitung nicht immer bewusst.
Individuelle Grenzen
Persönliche Grenzen sind nicht nur situationsbedingt, sondern auch sehr individuell. Diese Grenzen stellen einen persönlichen Raum dar, in dem wir entscheiden können, was erlaubt ist und was nicht. Deshalb ist das Empfinden, wann Grenzen überschritten wurden subjektiv und nur die betroffene Person kann entscheiden, wann ihre Grenzen überschritten wurden. Persönliche Grenzen können in fünf Kategorien unterteilt werden:
- emotionale Grenzen (eigene Gefühle in einer bestimmten Situation)
- physische/körperliche Grenzen (z.B. eigenen Raum, egal wie groß der sein mag)
- soziale Grenzen (z.B. eigene Freunde, Hobbies usw)
- intellektuelle Grenzen (z.B. eigene Gedanken & Meinungen)
- spirituelle Grenzen (eigener (Un-)Glaube/Spiritualität)
Konsens (enthusiastisch)
Nur ein enthusiastisches ‚“JA!“ heißt ja. Das heißt, ein “vielleicht später”, “Ich weiß nicht”, “eigentlich nicht” und Ähnliches sind keine aktiven Zustimmungen = NEIN. Zustimmung zu erfragen oder aktiv zu äußern kann ungewohnt sein. Wir liegen oft daneben, wenn wir von uns auf andere schließen oder stillschweigend vermuten, was ein anderer Mensch (nicht) will. Daher gilt: Konsens ist aktive Zustimmung aller Beteiligten, non-verbal oder verbal. Die beteiligten Personen befinden sich in einem transparenten Prozess, um eine gemeinsame Lösung zu schaffen. Konsens ist eine Methode zur Reflektion und Kommunikation von persönlichen Bedürfnissen, Grenzen und Wünschen und von daher intim und sau sexy.
Geschlechtsidentität (Gender)
Das Geschlecht, mit dem eine Person sich selbst identifiziert oder auch nicht. Es geht dabei um das soziale, das gelebte und das gefühlte Geschlecht. Die Geschlechtsidentität kann von dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht abweichen. Das gelesene (alltäglich interpretierte) Geschlecht muss nicht mit der Geschlechtsidentität übereinstimmen.
Gelesenes Geschlecht (weiblich/männlich gelesen werden)
Das Geschlecht, dass andere Personen einem Menschen aufgrund von Aussehen und Verhalten zuschreiben. Demnach ist eine weiblich gelesene Person, eine Person die von anderen als Frau wahrgenommen bzw. gelesen wird. Das bedeutet nicht, dass diese Person tatsächlich weiblich ist, sich als Frau identifiziert.
Gendersensible Sprache bzw. gendergerechte Sprache
Sprache so zu verwenden und einzusetzen, dass alle Geschlechter und Identitäten gleichermaßen sichtbar und wertschätzend angesprochen werden. Dass keinem existierenden Geschlecht und keiner existierenden Person die Existenz aberkannt wird.
Pronomen
Durch Personalpronomen können Beteiligte in Situation beschrieben werden oder sich im Gespräch auf Dritte beziehen. Im Deutschen sind die meistverwendeten Pronomen “er/sie”. Leider existiert in der deutschen Sprache noch kein rechtlich anerkanntes drittes Pronomen, wie zum Beispiel im Englischen (they/them) oder im Schwedischen (hen). Alternative geschlechtsneutrale Pronomen im Deutschen sind z.B. „sier” „xier”, „nin”, „dey“. Wenn du eine Person kennenlernst, frag neben dem Namen auch nach dem Pronomen (z.B.: Wie heißt du? Welche Pronomen benutzt du?). Auch wenn du über eine Person sprichst, deren Geschlecht du nicht kennst, ist die neutrale Variante die beste. Wenn du über eine Person redest, kannst du anstatt einem geschlechtsneutralen Pronomen auch „die Person” oder den Namen sagen.
Privileg
Ein Privileg ist ein nicht zu 100% verdienter, unproportionaler Vorteil gegenüber anderen Personen(gruppen). Ein Privileg liegt vor, sobald Personen durch Gruppenzugehörigkeiten oder -zuschreibungen strukturelle Vorrechte und Vorteile haben, die nicht (komplett) durch eigene Leistung oder besondere Qualifizierung erworben wurden. Diese gesellschaftlich eingeräumten Handlungsmöglichkeiten werden im Umkehrschluss anderen verwehrt oder erschwert. Privilegien erzeugen somit immer auch Benachteiligung anderer. In der privilegierten Position gestalten Privilegierte die Norm (Macht der Dominanzgesellschaft) und sind sich ihrer Privilegierung häufig nicht bewusst. Gerade aus einer privilegierten Position heraus gibt es Handlungsspielräume, mit denen sich genau das Privileg demokratisieren und damit im Endeffekt abschaffen lässt.
No Nipples Policy
ist eine kleine, aber feine Idee, sich solidarisch mit weiblich gelesenen Personen zu verhalten. Weiblich gelesene Personen können sich in der Hitze nicht einfach ihrer Oberkörperbekleidung entledigen ohne Sexualisierung, Objektifizierung, Stigmatisierung, Starren, heimliche Videoaufnahmen, Belästigung befürchten zu müssen und sich der Gefahr körperlicher Übergriffe (an denen sie dann auch noch „selbst schuld“ sind) auszusetzen. Mehr zur No Nipple Policy findet ihr hier.
Definitionsrecht
Im Zentrum des Definitionsrechts stehen die Perspektive und die Bedürfnisse der betroffenen Person, die den Ausgangspunkt jegliches weiteren Handelns bilden. Die einzige Person, die definieren kann, wann ein Übergriff oder eine Grenzüberschreitung stattfindet bzw. stattgefunden hat ist die betroffene Person. Dies beinhaltet ebenso die Form und Benennung der Gewalt oder Diskriminierung, die die betroffene Person erleiden musste. Situationen werden unterschiedlich wahrgenommen und Menschen haben individuelle emotionale und körperliche Grenzen. Deshalb kann es keine allgemeingültige Definition eines Übergriffs geben.
Definitionsrecht bezieht sich auf einen bestimmten Fall. Es ist möglich, dass Betroffene sich Unterstützung suchen, um das Erlebte im Austausch zu besprechen, verarbeiten und benennen zu können. Was nach einer Grenzüberschreitung oder Diskriminierung geschieht, richtet sich nach den Wünschen und Bedürfnissen der betroffenen Person.
Betroffene Person
Wir ziehen den Begriff “betroffene Person” dem Begriff des „Opfers“ vor. Letzterer impliziert den Einzelfall, Passivität, notwendige, irreparable Hilflosigkeit und kreiert „Opfer-Identität“. Die Bezeichnung „betroffene Person“ konzentriert sich mehr auf den Prozess der Grenzüberschreitung, hebt die strukturelle Komponente und das dahinterstehende System hervor: „Betroffene Person“ deutet auf die Alltäglichkeit hin, während das „Opfer“ eines außerordentlichen, einmaligen Ereignisses keine andere Wahl hat, als ein Opfer seines Schicksals zu werden.